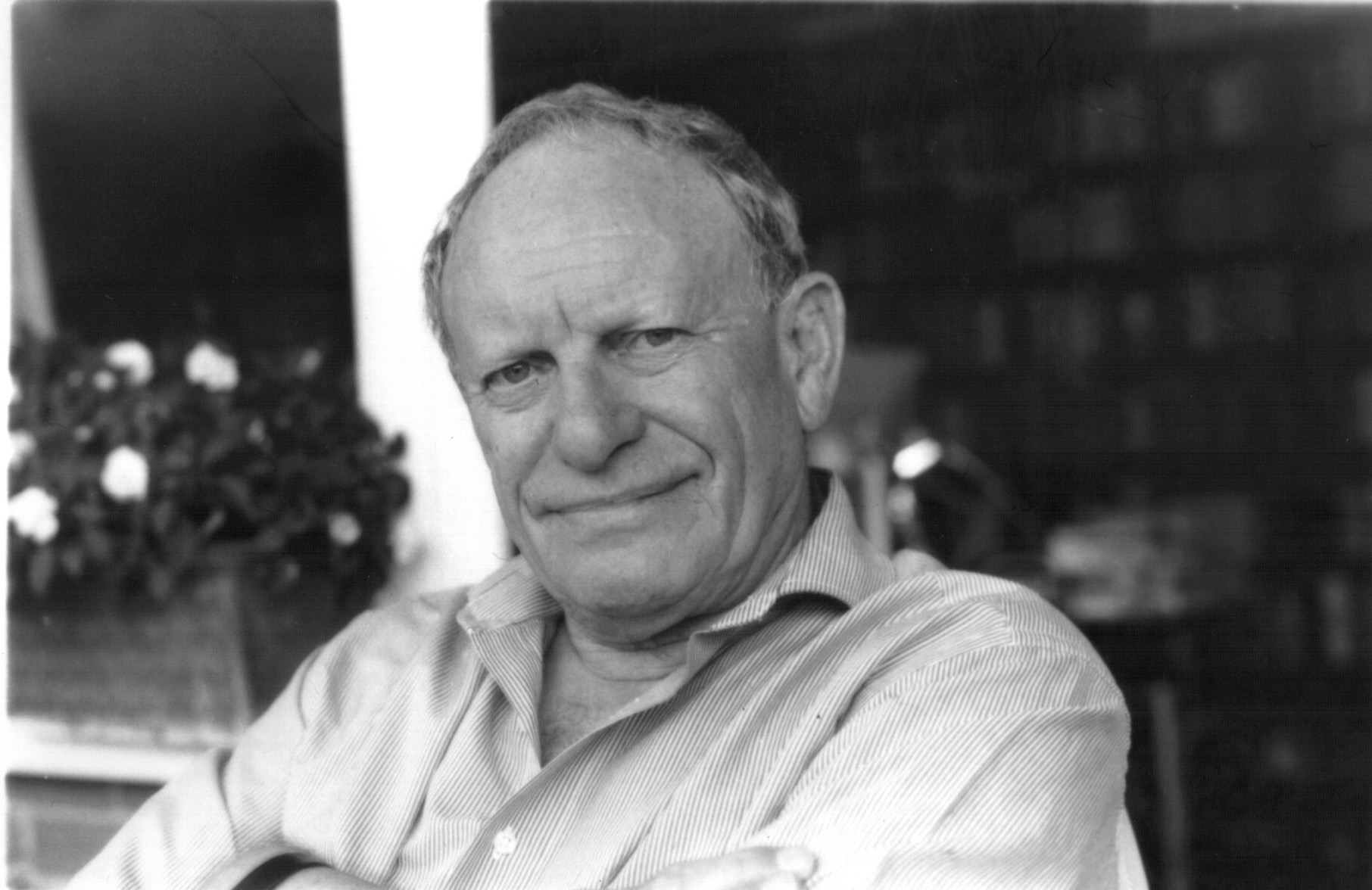Colette, Claudines Elternhaus. Roman. Aus dem Französischen und mit einem Nachwort von Elisabeth Edel. Paul Zsolnay Verlag. 175 Seiten. 24 Euro
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/colette-claudines-elternhaus-9783552075016-t-5507
Colette, die heute als Schriftstellerin neben Proust steht, beginnt mit ihren provozierenden „Claudine“-Romanen unter dem Namen ihres Mannes und mit skandalösen Varieté-Auftritten. Doch dann schreibt sie 1922 „Claudines Elternhaus“ unter ihrem eigenen Namen und erzählt über ihre Kindheit in einem kleinen burgundischen Dorf: Eine betörend zärtliche Hommage vor allem an ihre Mutter. – Über der Schriftstellerin Colette – die eigentlich Sidonie-Gabrielle Claudine Colette hieß und als Autorin erst ab 1923 nur ihren Mädchennamen ohne weiteren Vor- und Zunamen benutzte – lag bei uns in Deutschland lange der Ruf des Seichten. Das liegt unter anderem daran, dass die 1873 Geborene nach der Scheidung von ihrem ersten Ehemann 1903 ein reichlich skandalöses Leben als Varieté-Künstlerin führte. Aber auch daran, dass ihre frühen, bis 1903 unter dem Namen ihres Mannes geschriebenen „Claudine“-Romane schlecht übersetzt und als leichte Unterhaltungsliteratur gehandelt wurden. In Frankreich dagegen war sie bereits in den 1920er Jahren neben dem sie verehrenden Marcel Proust eine angesehene Schriftstellerin. 1920 wurde sie sogar zum „Ritter der Ehrenlegion“ ernannt. – Jetzt verlegt der Zsolnay-Verlag in der Neuübersetzung von Elisabeth Edel ihre Romane aus den 1920er Jahren neu – und sie erweist sich als eine überragende, den Rezensenten geradezu bezaubernde Stilistin.
Wer dieses Buch liest, kann sich nicht wundern, dass ausgerechnet Marcel Proust 1919 der Autorin schrieb, ihr Roman „Cheri“ sei tausendmal besser als seine Bücher und es bereite ihm ein großes Vergnügen „in ihrem Gehirn herumzuspazieren“. – Jetzt, wo die wunderbare Übersetzerin Elisabeth Edel dem deutschen Publikum Colette als überragende Stilistin nahebringt, kann man ermessen, wie verwandt beider – Prousts und Colettes – Gehirne tatsächlich waren. Und das heißt, wie hoch entwickelt auch Colettes Fähigkeit ist, die verlorene Zeit, die Vergangenheit, wieder zu erwecken. Bilden bei Proust oft die Gerüche den Schlüssel dazu, ist es bei Colette die ganze Palette der Sinne: Geräusche, Farben und der Geschmack. – Selbst beim Metzger.
Das schaurige Geräusch der vom frischen Fleisch abgezogenen Haut, die Rundheit der Nieren, braune Früchte in der makellosen Polsterung ihrer zartrosa Fetthülle, erregen mich in einer verzwickten Abscheu, die ich suche und zugleich verberge. Aber das feine Schmalz, das in der Kerbe des gespaltenen kleinen Hufs zurückbleibt, wenn das Feuer die Füße des toten Schweins zerreißt, das esse ich wie eine gesunde Leckerei.
Es ist Minet-Chérie, die hier spricht, – so wurde sie als Kind genannt – und sie erinnert sich nun als Colette an ihre Kindheit zwischen acht und dreizehn Jahren in einem kleinen burgundischen Dorf. – 1922, als „Claudines Elternhaus“ erschien, war der Begriff der Autofiktion weder erfunden noch gab es literarische Vorbilder, die einen ähnlichen Balanceakt zwischen Fiktion und Autobiografie gewagt hätten: Colette, die sich hier als literarische Avantgardistin erweist, benutzt den Namen der Heldin ihrer bisherigen Romane, um autobiografisch über ihre Kindheit, vor allem aber über ihre Mutter, genannt „Sido“, zu sprechen. Ohne den Einfluss dieser klugen und eigenwilligen, die Menschen wie die Pflanzen und Tiere gleichermaßen liebenden, rundlichen kleinen Frau kann man sich weder die kleine Minet-Chérie mit ihrem „gierigen Bedürfnis, lebendiges Fell zu berühren“, noch die erwachsene, ihre kleinen Hunde vergötternde Schriftstellerin vorstellen.
Wenn ich will, knittert der Wind das steife Papier der Bambussträucher und singt, von den Nadelkämmen der Eibe zerteilt in tausend Luftbächlein, um würdig die Stimme zu begleiten, die an jenem wie an allen anderen Tagen stets ähnliche Worte sprach: „Um dieses Kind muss man sich kümmern…Kann man diese Frau nicht retten? Haben diese Leute genug zu essen im Haus? Ich kann’s doch nicht umbringen, dieses Tierchen…“
Colette vermag mit ihrem nahezu beängstigend präzisen Gedächtnis wie mit einer betörenden, aber genauen, jeden einzelnen Farbton und jedes Geräusch exakt erfassenden Sprache den Lesern den Zauber einer Jugend in einer behüteten Familie auf dem Lande unmittelbar nahe zu bringen. Sie erzählt von einem Erdbeeren fressenden und versonnen den Duft blühender Veilchen schnüffelnden Kater. Von ihrem sechs Jahre älteren Bruder, dessen Leidenschaft es als 13-jähriger war, überall im Garten papierene Grabsteine fiktiver Verstorbener aufzustellen. Von der Begeisterung der kleinen Minet-Chérie für ländliche Dienstboten-Hochzeiten oder für den Burgunderwein, den sie als Siebenjährige bei Wahlkampfveranstaltungen ihres Vaters genoss. Sie erzählt von den Leuten im Dorf, von der überaus hübschen „kleinen Bouilloux“ zum Beispiel, die stolz den Tanz mit den Bauernburschen verweigerte und ihr ganzes Leben lang vergeblich auf einen Verehrer aus Paris wartete. – Beim Roman „Claudines Elternhaus“ geht es einem nicht anders wie Marcel Proust, der nach der Lektüre eines anderen Colette-Romans, „Mitsou“, schrieb: „Ich habe ein wenig geweint heute Abend…“
Meine Mutter roch nach frisch gewaschener Kretonne, nach dem auf Pappelholzglut erhitzten Bügeleisen, dem Blatt Zitronenverbene, das sie in den Händen rieb oder in ihrer Tasche zerkrümelte. Wenn der Abend kam, war mir, als verströme sie den Duft der eben gegossenen Salatköpfe, denn der kühle Duft wehte mit ihren Schritten, im Geriesel des Gießkannenregens, inmitten einer Gloriole aus Wasserperlen und Ackerstaub.
WDR3 Westart 8. Juli 2025