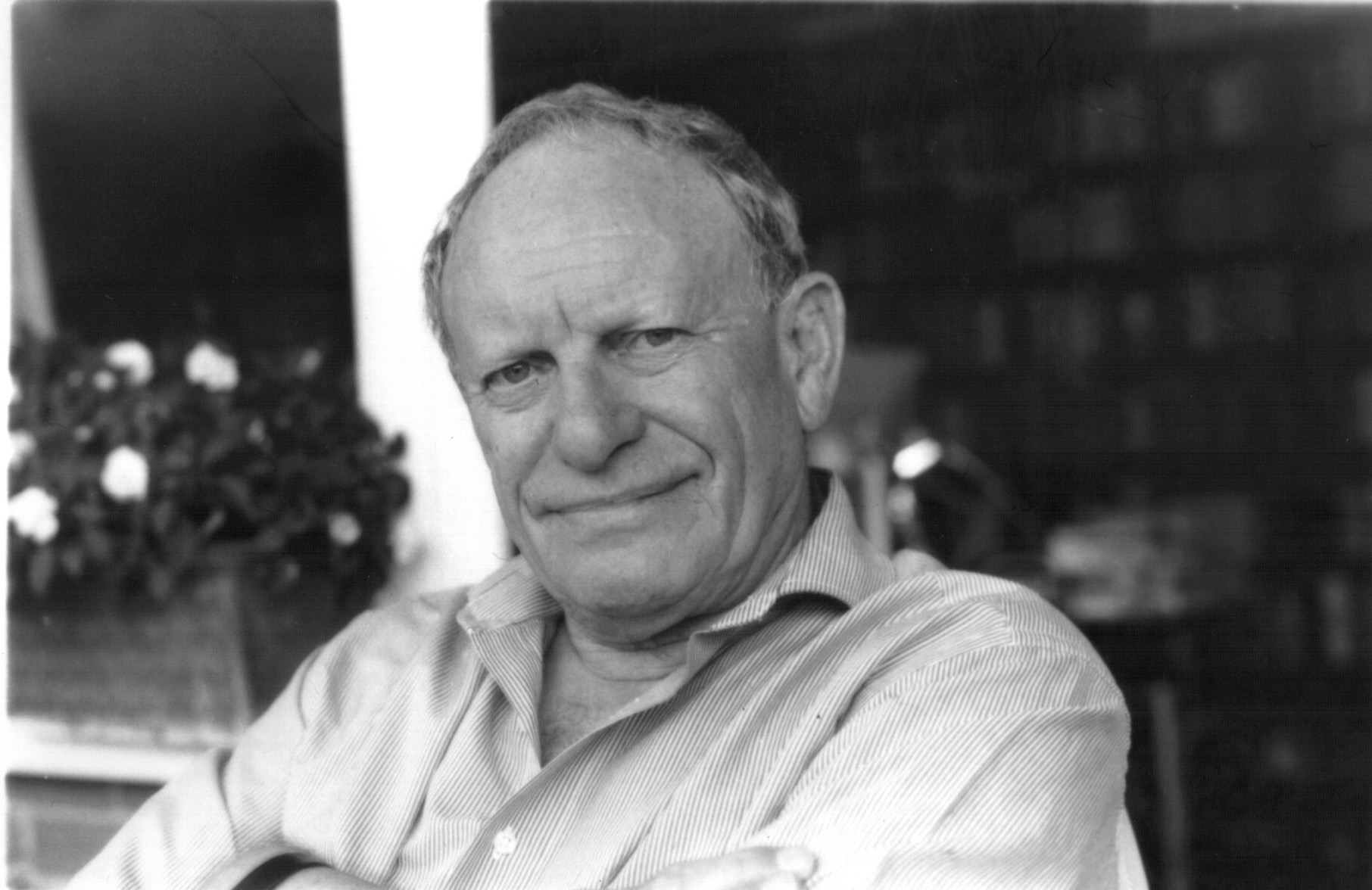Die meisten Wasserburgen und Wasserschlösser in NRW sind in Privatbesitz. Wenn man sie überhaupt besuchen kann, muss man in ein darin untergebrachtes Restaurant oder in den angeschlossenen Golfclub. Im Ruhrgebiet ist das etwas anders. Zumindest drei Wasserschlösser haben sich im Laufe des 20. Jahrhunderts die Gemeinden angeeignet und für die Allgemeinheit in Nutzung genommen: In Essen Schloss Borbeck, in Gelsenkirchen Schloss Horst und – als letztes Beispiel in meiner Reihe: In Gladbeck Schloss Wittringen. – Wie bei fast allen Wasserburgen in NRW reicht die Geschichte von Schloss Wittringen bei Gladbeck ins 13. Jahrhundert zurück. Doch hier ist von dem alten Rittersitz bis auf die Fundamente nichts mehr übrig. Auf diesen Fundamenten wurde im 18. Jahrhundert zwar ein neuer Adelssitz gebaut, der zweistöckige Fachwerkbau „Haus Wittringen“, – aber auch der wurde Anfang der 1920er Jahre durch eine historische Rekonstruktion ersetzt. Und zwar im Zuge einer Inbesitznahme des gesamten Schlossareals durch die Stadt Gladbeck: Sie machte aus Schloss Wittringen und seiner Umgebung ein Naherholungsgebiet für die Bewohner der Stadt mit einer weitläufigen Teich-Landschaft zum Bootfahren, Tennis- und Kinderspielplätzen. Im alten „Herrenhaus“ ist das Museum der Stadt Gladbeck untergebracht, daneben lädt ein vollkommen neu errichtetes „Schloss“ im Renaissancestil mit einer großen Terrasse zum Kaffeetrinken und Essen ein.
(Dokumentarfilm) So hat es ausgesehen, damals, untertage. Fortschritt gab es allenthalben. Aber es waren immer kleine Schritte. Die Muskelkraft war vorherrschend.
Natürlich spielt der Bergbau für Gladbeck eine große Rolle, weil im Zuge des Bergbaus Gladbeck erst groß geworden ist.
Susanne Peters-Schildgen leitet das Museum der Stadt Gladbeck in Schloss Wittringen.
Es gab hier früher fünf Zechen, auf denen Kohle gefördert worden ist. Und natürlich waren das lange Zeit die Hauptarbeitgeber für viele, viele Menschen, die aus allen Teilen nicht nur Deutschlands, sondern später eben auch aus heute polnischen Gebieten, aus dem früheren preußischen Osten angeworben sind und hier Arbeit und neue Heimat gefunden haben.
Doch warum das Museum der Stadt Gladbeck mit seinem Schwerpunkt auf der Arbeits- und Alltagskultur der Bergarbeiter außerhalb der Stadt in einem romantischen Fachwerkhaus inmitten eines idyllischen Ensembles aus einem Renaissance-Schloss und Teichanlagen untergebracht ist, erschließt sich erst nach einem Blick ins Archiv.
(Susanne Peters-Schildgen) Ich hab hier noch eine alte Festschrift ausgegraben, und zwar von der Einweihung hier des ganzen Ensembles in Wittringen. 17. Mai 1928 steht hier. Der Kauf erfolgte schon 1922. Es wurde wirklich umgestaltet zu einer Volkserholungsstätte, also heute beliebtes Naherholungsgebiet in Wittringen.
(Besucherinnen) Wir sind hier groß geworden in Gladbeck, und jetzt ist meine Schwester aus Münster zu Besuch und wir wollen heute noch mal so alles hier aufleben lassen, was wir hier gerne gesehen haben. Gladbeck ist ja schon immer eine Arbeiterstadt gewesen. Und was uns heute gewundert hat und wir haben uns gefragt: Wie sind die Arbeiter eigentlich an dieses schöne Schloss gekommen? Das war eine Frage, die wir uns bis jetzt noch nicht beantworten konnten.
Die Antwort ist einfach: Weil es zu Beginn der 1920r einen vorausschauenden Gladbecker Bürgermeister gab, der das fast verfallene Schloss samt den ganzen umliegenden Ländereien relativ günstig erwerben konnte. Die Gebäude wurden abgerissen und anschließend historisierend neu errichtet.
(Susanne Peters-Schildgen) Dazu gehört natürlich das Haus Wittringen, dazu gehört natürlich das Restaurantgebäude, was aber wirklich aussieht wie ein wirkliches Schloss und in der Architektur eines Renaissanceschlosses errichtet worden ist. Und natürlich die ganzen Gartenanlagen und auch die Sportanlagen, die Teiche. Dann hat man ein Schwimmbad gebaut, – man hat schon Ende der zwanziger Jahre die Tennisanlagen gebaut, Planschbecken für Kinder, Spielstätten. Um eben für die Bergarbeiterbevölkerung, für die Bevölkerung einer Industriestadt dieses Naherholungsgebiet zu errichten.
(Besucherinnen) Und das Tolle für uns Kinder war, dass man hier ein Ruderboot mieten konnte und dann sind wir also alle mit den Booten hier aufs Wasser gegangen und haben natürlich eine ordentliche Spritztour gemacht, sozusagen.
Die historische Burganlage befindet sich nämlich auf zwei Inseln inmitten einer weiten Teichlandschaft. Auf der größeren Insel steht das alte Herrenhaus, ein in den 1920er Jahren rekonstruiertes Fachwerkhaus, in dem heute das Museum untergebracht ist. Daneben ein ebenfalls in den 20er Jahren im Renaissance-Stil errichtetes Schloss-ähnliches Gebäude mit einer weitläufigen Restauration und einer großen Terrasse.
(Susanne Peters-Schildgen) Wir haben hier tatsächlich zwei Inseln, eine größere, auf der wir uns jetzt befinden und die Vogelinsel, die kleinere Insel. Diese kleinere Insel, die durch eine Brücke, auf der wir jetzt stehen, mit unserer Insel verbunden ist, war vermutlich der Ursprung von Haus Wittringen. Und man vermutet, dass dort schon vor über 760 Jahren ein kleiner Wohnturm, so eine mittelalterliche Motte, gestanden hat. Und gewohnt hat darin ein richtiger Ritter, nämlich Ludolfus, der Witteringer.
(Susanne Peters-Schildgen) Dass auch schon seit vielen Jahren, hier auf dieser kleineren Insel immer die Volieren in der wärmeren Jahreszeit mit Vögeln bestückt werden, vor allem sind es exotische Vögel. Volieren und exotische Vögel passen natürlich wunderbar zu einem Wasserschloss Wittringen, wir haben ja hier die exotischen Gesänge und Geräusche der Vögel, die höre ich übrigens bis ob in meinem Arbeitszimmer im Museum.
(Besucherinnen) Obwohl wir beide weggezogen sind, ist das immer noch unser Zufluchtsort. Wir kommen immer wieder nach Gladbeck zurück und gucken uns alles an. – Ich glaube, das geht aber vielen Gladbeckerinnen und Gladbeckern so, dass das als Erinnerungsort gesehen wird. Das ist glaube ganz wichtig.
WDR3 Mosaik 15. August 2025